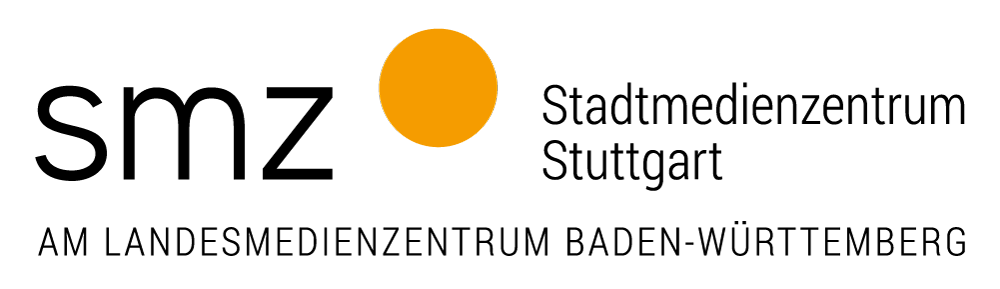Unsere Sendung läuft ab dem 23. Oktober jeden Montag von 15-16 Uhr bei Radio fips! Ab dem 23. Oktober 2023 haben wir mit unserer Sendung "SMZ - On Air" jeden Montag von 15:00 bis 16:00 Uhr unseren eigenen Sendeplatz im Freien Radio Göppingen: Radio fips. In den ersten zwei Sendungen stellt unsere Jugendredaktion das offene Freitagsangebot Game, Make & Learn der ComputerSpielSchule und des Makerspace vor. Es werden Liedwünsche von teilnehmenden Kindern und Jugendlichen bei Game, Make & Learn gespielt und interessante Gespräche geführt - also hört rein! Radio Fips kann im Kreis Göppingen über UKW auf 89,0 empfangen werden. Natürlich lässt sich die Sendung auch online hören: Der Link zum Internetradio von Radio fips findet sich unten. SMZ ON AIR | JEDEN MONTAG | 15-16 UHR Auch in den kommenden Wochen produziert die Jugendredaktion spannende Sendungen für unseren SMZ-Sendeplatz. Im Radioworkshop bei Game, Make & Learn könnt ihr dabei sein und Radio machen, jeden Freitag von 14 bis 18 Uhr. Wir freuen uns auf alle Teilnehmer*innen vor Ort sowie alle Hörer*innen der Radiosendung!
Beiträge

13. September 2023
AllgemeinVeranstaltung
Die ComputerSpielSchule auf der Gamescom 2023 – Einblicke, Interviews und Spielempfehlungen
Als Vertreter der ComputerSpielSchule Stuttgart waren Dejan Simonovic und Sakip Ahmed Özcan drei Tage vor Ort und haben die Gamescom in Köln besucht, das weltweit größte Event für Video- und Computerspiele. Volle Hallen, beeindruckende Cosplay Kostüme und das Feiern der Gamingkultur in allerlei Hinsicht – die Bilder, die die Beiden von der Gamescom mitgebracht haben, zeigen das besondere Feeling der Gamescom. Die Gamescom ehrte bei der Preisverleihungsveranstaltung „Gaming ohne Grenzen-Award“ verschiedene Firmen und Hersteller*innen, die sich besonders für Barrierefreiheit und die Repräsentation und Sichtbarkeit von Minderheiten einsetzen. Im Rahmen der Gamescom fand auch der Gamescom-Congress statt, bei dem in verschiedenen Programmpunkten gezeigt wurde, was Games für Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur sowie unser gesellschaftliches Miteinander leisten. Neben dem Thema Spiele im Kultur- und Bildungsbereich wurde auch der große Bereich KI (Künstliche Intelligenz) erörtert. Welchen Einfluss hat künstliche Intelligenz und kann KI kreativ sein? Auf diese Fragen ging Sarah Brin bei ihrer Keynote “Can AI be Creative?” ein. Ein weiteres spannendes Panel war „Lets Remember“, eine Diskussion über das Potential von Games für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Im Gespräch mit der Leadgame-Designerin von Paintbucket Games Leadgamedesignerin wurde klar, wie viel bei solchen Spielen beachtet werden muss: der sensible Umgang mit Themen der Vergangenheit und Geschichtsdarstellung ist essenziell bei der Spielentwicklung. Auch Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die Antisemitusmusbeauftragte von NRW, erkennt die Relevanz dieser Games: „[…] Es ist ganz wichtig, dass es daneben, Stichwort Serious Games, gerade auch im Bildungsbereich Spiele eingesetzt werden. Wir kennen Filme, wir kennen Lesungen, wir kennen Gebäude zum Erinnern, Steine, aber ich denke die Spiele gehören unverzichtbar dazu und da ist viel in Bewegung.“ Sie nennt im Interview mit Dejan Simonovic Through the Darkest of Times als Positiv-Beispiel für ein solches Game. Das Highlight des Gamescom-Congress ist jedes Jahr auch das Debatt(l)e Royale. Hier stellen sich Spitzenpolitiker*innen den Fragen der Games-Community und beziehen Stellung zu den wichtigsten Themen der Games- und Digitalpolitik. Dieses Jahr nahmen dabei Franziska Giffey (SPD), Nathanael Liminski (CDU), Emily Büning (Bündnis 90/Die Grünen) und Bijan Djir-Sarai (FDP) teil, moderiert wurde die Debatte von Kim "Freiraumreh" Adam und Maxim Markow. Weitere Themen, über die gesprochen wurde, waren die Fachkräfteausbildung in der Gamingbranche sowie die Erhöhung der Attraktivität des Gamingstandortes Deutschland. Hier lassen sich die Debatt(l)e Royale sowie einige der Paneldiskussionen des Gamescom-Congress nachschauen. Was die Gamescom letztlich ausmacht – die vielen Games, die dort gespielt und gezeigt werden. Hier findet ihr noch ein paar Highlights aus dem Bereich der Indie-Games, die Dejan und Ahmed auf der Gamescom anspielen konnten: Für noch mehr Details zur Gamescom, die ausführlichen Statements und weitere Game-Berichte, lohnt sich das Reinhören in die aktuelle Folge unseres Podcasts „GameBased“: hier oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen.

6. June 2023
AktuellAllgemein
Das Game-Event des Jahres: Die Gamescom 2023
Es ist wieder soweit: Die Gamescom geht in die nächste Runde! Das weltweit größte Event für Video- und Computerspiele öffnet mit seinem einzigartigen Festival-Charakter vom 23. bis 27. August 2023 in Köln seine Pforten. Fast eine Woche lang bietet die Gamescom ein vielfältiges Angebot für alle Fans des Gamings, E-Sports und Cosplays. Los geht es am Dienstagabend mit der Opening-Night-Live, bei der aktuelle Neuheiten aus der Welt der Games vorgestellt werden. Offiziell öffnet die Gamescom dann am Mittwochmorgen, für Privatbesucher*innen ist die Messe von Donnerstag bis Sonntag zugänglich. Im letzten Jahr fand die Gamescom erstmals wieder vor Ort statt, nachdem sie zwei Jahre nur virtuell ausgetragen wurde. Dementsprechend war der Ansturm auf die Gamescom 2022 groß: 265.000 Besucher*innen aus 100 Ländern, 130 Millionen Views, 1.100 Ausstellende aus aller Welt. Für die diesjährige Gamescom werden ähnliche Zahlen erwartet. Zusätzlich haben die Veranstalter angekündigt, dass große Unternehmen, die 2022 noch aussetzten, wieder Teil der Games-Messe sein sollen. Neue Releases, internationale Aussteller*innen, aktuelle Trends und der Austausch mit Freunden und Gleichgesinnten machen die Gamescom 2023 zum Computerspiel-Ereignis des Jahres – Das sollte man nicht verpassen! Je nach Interessen und Vorlieben können verschiedene Gamescom-Areas besucht werden: In der Indie-Area können die neuesten Indie-Spiele getestet und mit unabhängigen Spieleentwickler*innen gesprochen werden. Der Family&Friends-Bereich bietet die Möglichkeit für Kinder, Jugendliche und Familien, neue Technologien und pädagogische Games spielerisch in einem kindergerechten Umfeld kennenzulernen. Im Cosplay-Village trifft sich die internationale Cosplay-Community inklusive Zeichner*innen, Musik- und Show-Acts und Wettbewerben, während im Retro-Bereich Spielekonsolen und -automaten zum Zocken einladen. Auf dem Campus der Gamescom stellt die Gaming-Branche allen Interessenten verschiedene Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten im Gaming-Bereich vor. Zudem findet auch in diesem Jahr wieder der Gamescom Congress statt. Dieser befasst sich am 25. August mit den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, pädagogischen und kulturellen Potenzialen von Games. Ziel ist es, durch verschiedene Speaker und in Austausch mit Teilnehmenden zu beleuchten, was aus Spielen gelernt werden kann und wie sie für unser Lernen, Gesundheitswesen oder im kulturellen Diskurs genutzt werden können. So bietet der Kongress ein spezielles Angebot für medienpädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte. Im Bereich Jugend und Gaming bietet das Jugendforum NRW die gesamte Woche ein abwechslungsreiches, digitales Angebot für Kinder und Jugendliche, aber auch für interessierte Eltern und pädagogischen Fachkräfte. Die diesjährigen Themen werden in Kürze hier veröffentlicht. Zum offiziellen Programm und Ticketkauf der Gamescom: https://www.gamescom.de/de

19. April 2023
AktuellAllgemein
Grünen-Politikerin Dr. Anna Christmann zu Besuch in der ComputerSpielSchule
Am 14. April besuchte uns Frau Dr. Anna Christmann, um die ComputerSpielSchule Stuttgart und unser Game, Make & Learn Angebot zu kennenzulernen. Die Politikerin vom Bündnis 90/Die Grünen ist für den Wahlkreis Stuttgart II im Deutschen Bundestag und leitet die Koordination der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Außerdem ist sie Beauftragte für digitale Wirtschaft und Start-ups sowie ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit im Bundestag sind Innovations- und Technologiepolitik sowie Digitalpolitik. Mit ihrem Fachwissen konnte Anna Christmann die ComputerSpielSchule am Freitagnachmittag selbst miterleben, begleitet von Hans-Jürgen Rotter (SMZ-Leitung), Anna Zierer (Makerspace-Leitung) und Ahmed Özcan (stellvertretende CSS-Leitung). Dabei konnte sie vielfältige Einblicke in die Arbeit und Workshops der ComputerSpielSchule Stuttgart gewinnen: In der Holzwerkstatt wurden Kugelschreiber gedrechselt, im Cosplay-Workshop Zauberstäbe gebastelt und im Tonstudio eigene Musik produziert. Außerdem konnte sie bei einem Rundgang beobachten, wie die Kinder gemeinsam an verschiedenen Konsolen spielen und sich mit unseren pädagogischen Mitarbeitenden ins Game Design vertiefen.

17. January 2023
AktuellAllgemein
Anleitung für ein Minetest Cosplay
In diesem Tutorial wollen wir dir zeigen, wie man mit einem Karton und buntem Papier ganz einfach ein cooles, eigenes Cosplay machen kann. Zusammen kreieren wir einen Kopf eines Minetest Charakters. Alles was du für dafür brauchst: Anleitung Schritt 1 - Charakter auswahl Als erstes überlegen wir uns, was für einen Skin wir cosplayen möchten. Dementsprechend wählen wir unsere Papierfarben aus. Ich mache einen Creeper, dafür brauche ich die Farben hellgrün, dunkelgrün, und schwarz. Je nachdem wie häufig die Farbe in deinem Skin vorkommt, umso mehr Papier benötigst du. Insgesamt benötigst du mindestens 5 bis 6 Din A4 Blätter, um deinen ganzen Karton zu füllen. Schritt 2 - Karton vorbereiten Wenn ihr einen faltbaren Karton habt, solltet ihr als erstes die Klappen an einer Seite des Kartons abschneiden. Wenn dein Karton sehr dick ist, müsst ihr beim Schneiden aufpassen oder einen Erwachsenen um Hilfe bitten. Anschließend faltet ihr den Karton zusammen und fixiert ihn mit Klebeband. Schritt 3 - Die Grundfarbe aufkleben Zu Beginn bekleben wir den gesamten Karton mit einer Farbe. Dadurch haben wir eine Grundfarbe für unseren Kopf und am Ende ist kein Karton mehr zu sehen. Lege dafür ein oder mehrere A4 Blätter auf eine Seite des Kartons und verteile sie so, dass die ganze Fläche bedeckt ist. Nun verteilen wir Kleber auf dem Karton und kleben das Papier auf. Überstehendes Papier schneiden wir mit der Schere ab und kleben es auf freibleibenden Stellen. Schritt 4 - Pixel-Quadrate vorbereiten Als nächstes bereiten wir die Papier-Quadrate vor, welche wir später auf unseren Karton kleben, um Pixel darzustellen. Dafür nehmen wir ein Lineal und einen Bleistift und zeichnen Quadrate auf unser restliches farbiges Papier. Für die Größe der Quadrate kannst du einfach 4cm wählen. Wenn du ganz genau arbeiten möchtest, dann kannst du deinen Karton aber auch vermessen und dein eigenes Maß verwenden. Dazu misst du die breite der Vorderseite deines Kartons und Teilst diese durch 8. Das Ergebnis ist die neue Größe für deine Quadrate. Als nächstes ziehen wir Linien entlang der Papierkante mit je 4cm Abstand oder du verwendest deinen eigenen Maßabstand. Danach machen wir das gleiche an der anderen Papierkante. So erhalten wir ganz einfach viele Quadrate. Schritt 5 - Pixel-Quadrate ausschneiden Als nächstes schneiden wir diese Quadrate aus. Am besten schneidest du Streifen aus und legst diese dann übereinander. So kannst du viele Quadrate auf einmal ausschneiden. Schritt 7 - Raster aufzeichnen Um meine Quadrate im nächsten Schritt genau anlegen zu können zeichnen wir mit Bleistift ein Raster auf alle Seiten unseres Kartons. Dazu gehen wir genauso vor wie bei Schritt 4. Schritt 8 - Pixel aufkleben Jetzt kommen wir endlich zum Basteln. Ich fange dabei mit der Vorderseite und dem Gesicht meines Skins an. Vor dem Kleben ist es gut, die Quadrate erst einmal auf den Karton zu legen. Dadurch kann man ausprobieren wie verschiedene Designs aussehen und es noch abändern. Wenn du zufrieden bist, dann kannst du anfangen die ersten Quadrate aufzukleben. Fange mit dem Kleben am besten vom Rand aus an. Nimm dir immer ein Quadrat, mache Kleber auf die Stelle an welche es soll und drücke es dann dort fest. Wenn du mit der Vorderseite fertig bist, dann kannst du mit den anderen Seiten weitermachen. Wiederhole dafür einfach die gleichen Schritte wie davor. Lege erst die Quadrate auf deinen Karton und klebe sie dann nacheinander fest. Schritt 9 - Löcher zum Durchschauen Um beim Tragen deines Minetest-Cosplays etwas sehen zu können, musst du Löcher hineinschneiden wo deine Augen sitzen.Dazu setzt du deinen Karton auf deinen Kopf und legst von außen deine Finger auf die Stellen am Karton wo innen deine Augen sind. Lass dir von jemandem sagen, auf welche Pixel du dabei zeigst. Als nächstes schneidest benutzt du das Cuttermesser um diese Quadrate auszuschneiden. Frage deine Eltern um Erlaubnis, ob du ein solches Messer benutzen darfst und ziehe Schutzhandschuhe an. Achte außerdem darauf, dass das Messer nicht zu weit ausgefahren ist. Fertig ist unser Minetest Cosplay! Wie sieht dein Minetest Skin aus? Schickt uns gerne euer Cosplay per E-Mail an computerspielschule@lmz-bw.de oder per Instagram an @computerspielschule_stuttgart. Und vergesst nicht, beim Cosplay fangen alle klein an.

20. December 2022
Allgemein
„Fortnite“-Entwicklerstudio muss Rekordsumme in Höhe von 512 Millionen Dollar zahlen
In dieser Woche gab die US-Verbraucherschutzbehörde FTC einen Vergleich mit dem Spielentwickler „Epic Games“ in Höhe von einer halben Milliarden Dollar bekannt. Dem US-Unternehmen, das unter anderem für die Entwicklung des weltberühmten „Fortnite“ bekannt ist, wurde vorgeworfen, Kindern und Jugendlichen geschadet zu haben, indem sie ihnen Chats in Echtzeit mit erwachsenem Spieler*innen ermöglichten. Überdies habe „Epic Games“ persönliche Daten von unter 13-Jährigen ohne Zustimmung der Eltern gesammelt und Kinder durch eine irreführende Menüstruktur zu unbeabsichtigten In-Game-Käufen verleitet. Auch hier bei uns an der Computerspielschule Stuttgart war und sind Monetarisierungsstrategien und unzureichender Schutz der Rechte von Kindern auf Spieleplattformen ein wiederkehrendes Thema. Immer wieder tragen Eltern und Lehrkräfte ihre berechtigten Sorgen an uns heran. Zugleich können wir diese häufig beruhigen: Viele Kinder und Jugendliche spielen in privaten Online-Räumen mit ihren Freund*innen und bauen sich so eigenständig einen geschützten Bereich. Im Fall „Fortnite“ ist es zudem nicht die dargestellte Gewalt („Fortnite“ ist ab 12 Jahren freigegeben), die sich schädlich auf Kinder und Jugendliche auswirkt, sondern In-App-Käufe oder fehlende Moderation seitens der Spielebetreiber. Spiele wie „Fortnite“ haben wir deshalb schon seit langer Zeit aus unserem Angebot gestrichen. Wir begrüßen den Vergleich zwischen der US-amerikanischen Verbraucherschutzbehörde und „Epic Games“ und erhoffen uns für die globale Computerspiellandschaft eine nachhaltige Wirkung.

25. November 2022
AktuellAllgemein
Rollout Toolkit Medienzentren BW
Am 21.11.2022 erschien die 2. Auflage des "Games im Unterricht"-Toolkitkoffers. Diese werden an die Medienzentren im ganzen Land verteilt. Der Koffer richtet sich an Lehrkräfte im Fachbereich Informatik und enthält sechs Module für den Informatik-Unterricht, um praktisch und projektbezogen Schülerinnen und Schüler die erforderlichen Grundlagen zu vermitteln. Diese eignen sich, entsprechend des baden-württembergischen Bildungsplans der Klassenstufe 7, für den Einsatz beim Coding-, Gamedesign- und Robotikprojekten. Die Toolkitkoffer können auch außerhalb des Unterrichts, für Projekttage, in anderen Klassenstufen und im Fernunterricht eingesetzt werden. Die Toolkitkoffer sind ab sofort in über 30 Landkreisen an den entsprechenden Kreismedienzentren ausleihbar. Näheres zum Tookit findet Ihr auf https://games-im-unterricht.de/toolkit.

25. November 2022
AktuellWissen
Games im Unterricht: Ratgeber zu den Risiken
In dem folgenden Beitrag des Serviceportals für Verbraucherbildung spricht Dejan Simonović Leiter der ComputerSpielSchule Stuttgart mit der Verbraucherzentrale über das Thema Computerspielsucht und wie diese im Zuge der Medienkompetenzförderung präventiv im Unterricht aufgegriffen werden kann. Zum Interview der Verbraucherzentrale geht's hier: https://www.verbraucherbildung.de/meldung/games-im-unterricht-die-risiken-im-blick

14. March 2022
AktuellAllgemein
Vorstellung des Games im Unterricht Toolkit
Das neue Games im Unterricht Toolkit bietet praktische und projektbezogene Konzepte für den Informatikunterricht. Der Koffer besteht aus sechs Modulen samt Hard- und Software-, die informatische Grundlagen, wie Codierung, Algorithmen und Programmierung spielerisch vermitteln. Die Geschichten der Comic-Helden Platina und Chip führen die Schülerinnen und Schüler durch die verschiedenen Module. Gemeinsam programmieren sie Roboter, reparieren Programme und jagen die Bad Bugs. Das Toolkit wurde auf Grundlage des baden-württembergischen Bildungsplans für den Informatikunterricht der Klassenstufe 7 konzipiert, eignet sich aber auch für weitere Altersstufen und kann ebenso an Projekttagen, innerhalb von AGs oder als Ferienprogramm auch ohne große Vorkenntnisse eingesetzt werden. Module im Toolkit-Koffer Modul 1: Bug Bounty (Analog) Modul 2 : Bug Panic (Programmierenmit Scratch) Modul 3 : Color Coder (Game-Design mit Bloxels) Modul 4 : Remote Control (Experimente mit MakeyMakey) Modul 5 : Patching (Programmieren in Minetest) Modul 6 : Robotik (Programmieren mit Codey Rocky)

9. March 2022
AktuellAllgemein
Games in der Pandemie – Ein Interview mit Gaming Experte Dejan Simonović
In der Pandemie haben Kinder und Jugendliche deutlich mehr Zeit mit Games verbracht. Sind Videospiele in der Corona-Zeit eine Suchtgefahr oder eine Chance? Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg hat diesbezüglich mit Dejan Simonović gesprochen, dem Leiter der ComputerSpielSchule Stuttgart. Im Interview erklärt Dejan, was eine Spielsucht auszeichnet, gibt Ratschläge für Eltern und berichtet über die positiven Auswirkungen von Videospielen.

AllgemeinVeranstaltung
Game Design und 3D Druck Workshops
Im Juni fanden bei uns an der ComputerSpielSchule zwei spannende Workshops zum Thema Game Design und 3D Druck statt. Mit der App Bloxels konnten die Schüler*innen erste Einblicke ins Game Design bekommen und ihre eigene Spielwelt erschaffen. Dabei haben sie das Aussehen der Welt, die Spielfigur und ihre Animationen sowie Gefahren und Gegner selbst erstellt. Auch den Hintergrund und die Musik im Game konnten die Schüler*innen selbst auswählen - der Kreativität wurden hier keine Grenzen gesetzt. Im Rahmen eines NWT-Schulprojekts erstellte die Schulklasse ihre eigenen 3D Figuren. Von der Konzeption bis hin zum finalen Druck haben wir die Schulklasse bei ihrem 3D Druck Projekt unterstützt. Hier seht ihr ein paar Impressionen aus den beiden Workshops:

28. February 2022
AktuellAllgemein
YouTuberin Coldmirror zu Gast beim Game Based Podcast
In der dritten Folge des Game Based Podcasts geht es um Moral, Moralentwicklung und moralische Dilemmas in Games. Hierzu betrachten wir die verschiedenen Perspektiven welche man in Spielen einnehmen kann, welche Position man neigt einzunehmen und ob Games überhaupt moralisch sein müssen. Hierfür haben wir mit der Youtuberin Kathrin Fricke aka Coldmirror gesprochen und ihre Erfahrungen mit einfließen lassen. Das volle Interview wurde in voller Länge in einem Extra hochgeladen. Spiele die wir angesprochen haben: The Witcher ReihePapers, PleasePen & PaperDungeons and Dragons (Kein Videospiel, sondern analog)Baldur's GateGrand Theft Auto

10. February 2022
Allgemein
TRAILER Minetest Story Time
Die Minetest Story Time hat jetzt einen Trailer! Jeden Freitag von 14.30 bis 16.30 Uhr spielen wir gemeinsam online die Minetest Story Time. In Minetest bauen wir gemeinsam an unserer eigenen Welt. Außerdem gibt es jede Woche neue Abenteuer, Herausforderungen und eine spannende Geschichte. Hilf Mupsi Merol seine Oma vor dem bösen Tis Tema zu retten! Hast auch du Lust mitzuspielen?

10. June 2024
AktuellAllgemein
Die Kontroverse um Sweet Baby Inc.
In der Welt der Videospiele, wo Geschichten und Charaktere über Bildschirme zum Leben erwachen, steht Sweet Baby Inc. Im Rampenlicht einer hitzigen Debatte. SBI ist ein Entwicklungs- und Beratungsstudio mit Sitz in Montreal, Kanada. Dabei berät sie Videospieleentwickler während der Entwicklung, um Vielfalt, Gleichberechtigung, kulturelle Sensibilität und Inklusion in Spieleerzählungen und Studios zu fördern. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Spiele ansprechender, unterhaltsamer, bedeutungsvoller und inklusiver für alle zu gestalten. Dabei haben sie bereits an großen Titeln wie beispielsweise God of War Ragnarök oder Alan Wake 2 mitgewirkt und wird von vielen Entwicklerfirmen angefragt. Deren Ziel ist es wiederum, dass beim Release des Spiels kein Fehltritt passiert, der dann auch kommerziell negative Folgen haben könnte, wenn ein Spiel in einem Land und damit auf einem möglicherweise relevanten Markt nicht veröffentlicht werden kann oder einen Shitstorm auslöst. Das Problem an der Sache Das Problem ist hierbei nicht etwa die Firma selbst, sondern eine Art Community, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, jedes Spiel zu cancelen, welches die Arbeit der Sweet Baby Inc. in Anspruch genommen hat. Der „Anführer“ dieser Gruppe ist dabei der Steamkurator (Personen die Empfehlungen schreiben, um anderen bei der Entdeckung interessanter Spieler im Steam-Katalogs zu helfen) „Kabrutus“, der mit seiner Kuratorenseite auf Steam mit dem Accountname „Sweet Baby Inc detected“ alle diese Spiele schlecht bewertet – ob er sie nun gespielt hat oder nicht. Sein Account hat sogar über 350.000 Follower. Der Hass, der der Firma dadurch entgegenschwappt, nimmt massive Ausmaße an, es folgten Reddit- und Steam-Foren sowie ein Discord-Server, auf dem dazu aufgerufen wird, die mit Sweet Baby Inc. kooperierenden Entwicklerstudios mit Hassnachrichten zu bombardieren. Einige Nutzerinnen und Nutzer auf dem Server stellen offen rechtes Gedankengut dar, wie beispielsweise die Aussage, dass die EU in einem besseren Zustand wäre, wenn Deutschland den 2. Weltkrieg gewonnen hätte. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass dies natürlich nur eine Minderheit dieser Gruppe repräsentiert und sich die meisten Menschen nicht aktiv an der Hetze beteiligen und die Moderatorinnen und Moderatoren des Discord-Servers diese bestimmten Personen gebannt haben. Die Problematiken beider Seiten im Fokus Dass dieser ganze Hass gegenüber Sweet Baby Inc. ein massives Problem für die Gesellschaft darstellt, steht außer Frage. Das Geschäftsmodell von Sweet Baby Inc. steht doch eigentlich für Gleichberechtigung aller Geschlechter, für Vielfalt und kulturelle Sensibilität. Doch die Menschen, die sich aktiv an der Hetze gegen das Unternehmen beteiligen sehen diese Hilfe als „Wokeifizierung“ sowie zu einer verminderten Qualität von Videospielen. So ist beispielweise eine Problematik der Mithilfe von Sweet Baby Inc., dass Frauen nichtmehr nur halb bekleidet in Games auftreten, Männer nicht mehr alle weiß und muskelbepackt sind. Alles, was nicht einem Bild von vor vielen Jahren entspricht sei woke und zerstöre die Gaming-Kultur. Weniger drastische Stimmen sind der Meinung, dass es erzwungene Situationen schafft und damit Spielen ihren natürlichen Fluss rauben würde. Der Kurator selbst sagt zu dem Thema, dass seine Gruppe selbst sehr divers wäre und sieht dies als Begründung dafür, dass die Hetze gegen Sweet Baby Inc. keinen sexistischen oder rassistischen Hintergrund habe. Des Weiteren habe er auf X (ehemals Twitter) dazu aufgerufen, keinen Hass und Hetze zu verbreiten und lässt auch seinen Discord Server moderieren - was jedoch einige nicht davon abgehalten hat, sich Pro-Nationalsozialistisch zu äußern. Manchmal kann man auch das Verhalten von Mitarbeitenden von Sweet Baby Inc. in Frage stellen Ein Mitarbeiter äußerte sich auf Twitter zu der Kuratorengruppe und rief seine Followern dazu auf, die Gruppe sowie den Betreiber ebendieser zu melden, mit dem Ziel, dass dieser seinen Account verliere. Eine andere Mitarbeiterin äußerte sich auf Twitter immer wieder abwertend gegenüber weißen Menschen und verfasste 2014 einen Tweet mit den Worten „abort all Jews“, was eine öffentliche Bekennung zu Rassismus gegenüber weißen und offensichtlich antisemitischen Inhalt darstellt. Fazit Ein weiteres Problem stellen Hypothesen dar, die davon ausgehen, dass Sweet Baby Inc. für eine gezwungene Diversität in Spielen sorgen würde. Doch unsere Welt ist divers, sie ist nicht weiß, männlich und extrem muskulös. Warum sollten Spiele also das Gegenteil sein? Ist es also eine gezwungene Diversität? In meinen Augen nicht, es ist eine Repräsentation unserer Lebenswelten und sollte auch als solche gesehen werden. Es wäre durchaus fraglich, Spiele weiter so zu entwickeln, wie es noch vor vielen Jahren der Standard war. Eine Stigmatisierung von Geschlechterrollen, Sexualisierung von Frauen oder auch die Misrepräsentation verschiedenster Kulturen. So entstand eine Grundsatzdebatte, die in einer Hasswelle endete, ob die Änderungen, welche Sweet Baby Inc. in der Gamingindustrie angestoßen hat, schon lange nötig waren, oder eine übertriebene Diversifizierung der Szene darstellen.

23. November 2023
GameChecker
Die GameChecker testen…
In diesem knallbunten Indie-Game ist der Name Programm: Umziehen, so lautet die Mission der Spieler*innen in Moving Out. Was in der Realität ein Knochenjob ist, bereitete unseren Testern als Computerspiel enormes Vergnügen.

26. October 2023
GameChecker
Die GameChecker empfehlen…
Die The Legend of Zelda -Reihe ist sagenumwoben. Jede*r Gamer*in und alle Eltern kennen das Spiel - Zelda ist von jüngeren und älteren Menschen geliebt.
Unser Tester Demu empfiehlt euch den neusten Teil der Spielreihe.

26. October 2023
GameChecker
Die GameChecker testen…
Team Sonic Racing ist der neuste Fun-Racer aus dem Hause des berühmten Spieleherstellers Sega. Das lebhafte Rennspiel erschien 2019 für alle gängigen Spielplattformen und greift einmal mehr das Universum um den wohl berühmtesten Igel der Welt auf. Parallelen zum Gaming-Hit Mario Kart sind dabei nicht zu übersehen. Doch kann Sonic mit dem italienischen Klempner mithalten?

14. June 2023
Allgemein
TinkerToys Workshop am 23.06.
WERDE ZUM SPIELZEUGERFINDER! Wir haben wieder ein neues Workshop-Angebot: Am 23.06. ab 14:30 Uhr findet im Stadtmedienzentrum Stuttgart ein TinkerToys Workshop statt! In unserem Kurs lernst du konstruieren und gestaltest deinen eigenen Roboter, eine eigene Figur oder ein Fahrzeug. Dabei sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt! Die Figuren werden nach dem Workshop mittels 3D-Druck aus einem umweltfreundlichen Biokunststoff hergestellt. Der Kurs richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 14 Jahren und erfordert keinerlei Vorkenntnisse. Anmelden könnt ihr euch mit einer kurzen Mail an: computerspielschule@lmz-bw.de Wir freuen uns auf alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen!
Adresse
Stadtmedienzentrum StuttgartRotenbergstraße 111
70190 Stuttgart
Öffnungszeiten
Jeden Freitag 14:00–18:00 Uhr